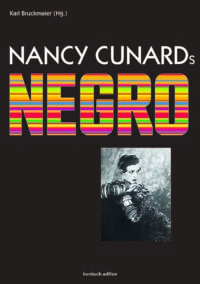Kursbuch 205 – Editorial
Musikboxen oder Jukeboxen sind die Wundertüten des Musikalischen. Aber was darin zu finden war, war nicht beliebig. Sie wurden mit Unterschiedlichem bestückt – aber im Unterschied der wählbaren Stücke waltete meist eine Einheit, ein Rahmen, eine starke Erwartung. Sie waren vor allem für popmusikalische Rezeption im (halb)öffentlichen Raum unverzichtbar und kombinierten Wählbarkeit mit Standardisierung. Unsere Musikbox soll allerdings keine Wurlitzer sein, die nur die Variation eines Stils wählbar macht. Sie ist gar nicht stilsicher – deshalb wagt sie sich an ganz unterschiedliche Formen, Medien und Grenzen des Musikalischen.
Überhaupt ist die Musik vielleicht die subtilste Kunst, weil sie so weit weg von semantischer Bedeutung und sichtbarer Gestalt, von Repräsentation und Persistenz ist, dass sie die Spannung zwischen dem Stilistischen, dem Festgelegten, dem Musterhaften auf der einen Seite und der Flüchtigkeit, der Vergänglichkeit und der Gegenwärtigkeit auf der anderen Seite besonders radikal auf den Begriff bringt – nein, das stimmt gar nicht: gerade nicht auf den Begriff. In der Musik wird die Spannung zwischen Präsenz und Gegenwärtigkeit besonders sichtbar: Präsenz als das unerreichbare Ziel aller Bezeichnung, in der Kunst sogar ohne die Chance, diese Erreichbarkeit zu simulieren, aber all das vorgeführt in einer Gegenwärtigkeit, die der Musik eingeschrieben ist: Sie muss hier und jetzt gespielt, gesungen und gehört werden – selbst wenn sie auf Tonträgern gespeichert ist oder durch Notation wiederholbar wird. Nicht umsonst hat Edmund Husserl, der Begründer der phänomenologischen Philosophie, das innere Zeitbewusstsein an einem Musikbeispiel erklärt: Das rein physiologische Hören einer Melodie besteht nur aus dem Nacheinander von Tönen, die Verbindung zu einer Melodie liegt nicht in den Tönen, sondern in der Eigenleistung des Bewusstseins, aus den Wahrnehmungsgegenwarten ein Aktkontinuum zu machen, einen Bewusstseinsstrom, der Identität nur durch die Verbindung differenter Punkte herstellen kann – und in jedem Augenblick wieder verliert. Weiter gedacht heißt das: Wäre unser Bewusstsein ein Analogon einer Kunstform, dann wäre dies die Musik.
In diesem Kursbuch geht es um sehr unterschiedliche Dinge – aber alle zeigen, wie sehr es die musikalische Erfahrung ist, die in die unterschiedlichen Nischen der Gesellschaft eindringen kann. Karl Bruckmaiers Reflexion über Listen, Charts und Hitparaden macht darauf aufmerksam, wie in der Popkultur (aber nicht nur dort) über solche Klassifikationssysteme sowohl Ordnung als auch Konkurrenz, sowohl Identität wie auch Differenz hergestellt wird. Bruckmaier zeigt, wie die zählbare Liste, die Liste als Ausdruck einer Ordnung durch Voting bereits analog zu einer Festlegung der Erfahrung auf Erwartbares geführt hat, was in digitalen Listen (etwa durch algorithmische Playlists im werbefinanzierten Radio) auf die Spitze getrieben wird und womöglich das musikalisch Überraschende unterminiert.
Das musikalisch Überraschende ist Gegenstand von Manfred Flügges wunderbarer Tour d’Horizon durch Rossinis Leben. Dieser erlebte einen »musikalischen Jetset im Postkutschenzeitalter«, in einem von nationalen Auseinandersetzungen geprägten frühmodernen Europa. Rossini lebte gewissermaßen, sehr aktuell, an den musikalischen Schnittstellen und Grenzen der entstehenden europäischen Nationalstaaten – und das Medium der Oper war für ihn geprägt von der Utopie der Versöhnung. In den Worten von Flügge ist sie »die reale Präsenz gemachter und gefügter Illusionen«.
Wie sehr die Musik freilich von dieser Welt ist, zeigt der Beitrag von Kathrin Hasselbeck, die den schwierigen Weg von Dirigentinnen nachzeichnet, die in diese Welt der heroischen Männergestalten seit Ende des 19. Jahrhunderts gegangen sind und gehen. »Sie können es nicht mehr hören, die Dirigentinnen, das Frauenthema«, schreibt Hasselbeck – und markiert sehr genau die Paradoxie dieses Themas: Es ist ein Frauenthema, solange das Dirigat keine Selbstverständlichkeit auch für Frauen ist. Die musikalische Praxis ist in gesellschaftliche Erfahrungen eingebettet – wie könnte es anders sein?
Das ist übrigens auch das Thema des Philosophen Jürgen Manemann, der gemeinsam mit dem Rapper und Hip-Hoper Spax in einem gemeinsamen Schreibexperiment zeigt, wie der Hip-Hop auf die unmittelbare Erfahrung der Beteiligten setzt und so ganz anders auf musikalische Formen, Traditionen und Konserven zurückgreift als andere Musik. Der Text hat selbst die Geschwindigkeit einer solchen Form.
Harry Lehmann widmet sich der Digitalisierung des Musikalischen. Er zeichnet an der historischen Veränderung von Leitmedien – Oralität, Schriftlichkeit, Digitalität – nach, wie sich die musikalische Praxis, aber auch die musikalische Form durch die entsprechenden Medienwechsel verändert. Musik nutzt nicht unterschiedliche Medien, sondern die kulturelle Form des Musikalischen ist selbst ein Ausdruck seiner Medialität. Lehmann zeigt das etwa an der Möglichkeit, auf digitale Speichermedien zuzugreifen, um musikalische Formen selbst mit digitalen Mitteln weiterlaufen zu lassen. Die klassische Notation wird damit selbst noch einmal anders mediatisiert.
Armin Griebel widmet sich der sogenannten »Volksmusik« und schreibt einerseits gegen den Mythos der primordialen, der ursprünglichen, der echten, eben nicht gekünstelten Musik an, wie es gerade in der »völkischen« Kritik der Moderne zum Vorschein kommt. Andererseits spürt er einer Form nach, die, wenn sie sich von den alten ethnischen und völkischen Elementen entfernt, ein Genre zwischen den Genres ist und wie alle Pflege der Tradition erkennen muss, dass Traditionen nicht aus der Vergangenheit stammen, sondern in der Gegenwart gemacht werden.
Mein eigener Beitrag begibt sich auf eine soziologische Suche nach der Symphonie als extremster Form des Musikalischen – in dem Sinne, dass gerade diese musikalische Form, die so etwas wie eine musikalische Reinheit völliger Selbstreferenz auf die Musik behauptet, eben das nicht sein kann.
Unterbrochen werden die Beiträge von Intermezzi, von Lockdown-Musik. Wir haben zwölf Künstler/innen und Kulturleute im weitesten Sinne um kleine Bekenntnisse gebeten, welche Musik ihnen durch den Lockdown geholfen hat, was sie im Lockdown gehört haben und warum. Die Intermezzi von Michael Kreuz, Dmitrij Kapitelman, Thorsten Nagelschmidt, Jagoda Marinić, Ulrike Draesner, Gustav Seibt, Hans Hütt, Carsten Brosda, Robert Habeck, Berit Glanz, Sibylle Lewitscharoff und Wolfgang Schmidbauer zeichnen ein beredtes Bild darüber, wie sehr sich die Musik in unsere Erfahrung einspeist und sie affiziert. Vielleicht sind diese Intermezzi auch ein Hinweis darauf, dass unser Bewusstsein womöglich tatsächlich der Serialität, der Gegenwärtigkeit und der verschwindenden Präsenz der Musik nachempfunden ist. Das (nicht historisch, aber systematisch) erste Schriftdokument behauptet, am Anfang sei der Logos gewesen. Vielleicht ist es der Klang gewesen.
Hätte ich selbst ein solches Intermezzo geschrieben, wäre meine Corona-Musik (zumindest im ersten Lockdown) das »Pur ti miro« aus Monteverdis L’incoronazione di Poppea – gespielt von Christina Pluhars L’Arpeggiata, gesungen von Nuria Rial und Philippe Jaroussky – und jedes Mal habe ich mich über den bescheuerten Kalauer gefreut, dass eine Krönung gar nichts mit Corona zu tun hat.
Übrigens: Die Kolumne FLXX fällt diesmal aus. Ich habe meinen Mitherausgeber Peter Felixberger gebeten, aus Infektionsschutzgründen diesmal auf seine Zeit- und Weltraumreisen zu verzichten – die nachträgliche Quarantäne wäre einfach zu lang und beschwerlich gewesen.
Kursbuch 205, Editorial
Armin Nassehi
-
Versandkostenfrei in Deutschland
-
Versandkostenfrei in Deutschland
-
Gedruckte Bücher ins Ausland zzgl. Versandkosten
-
Versandkostenfrei in Deutschland