Die träge Masse. Über die Unterschätzung konservativer Bezugsprobleme.
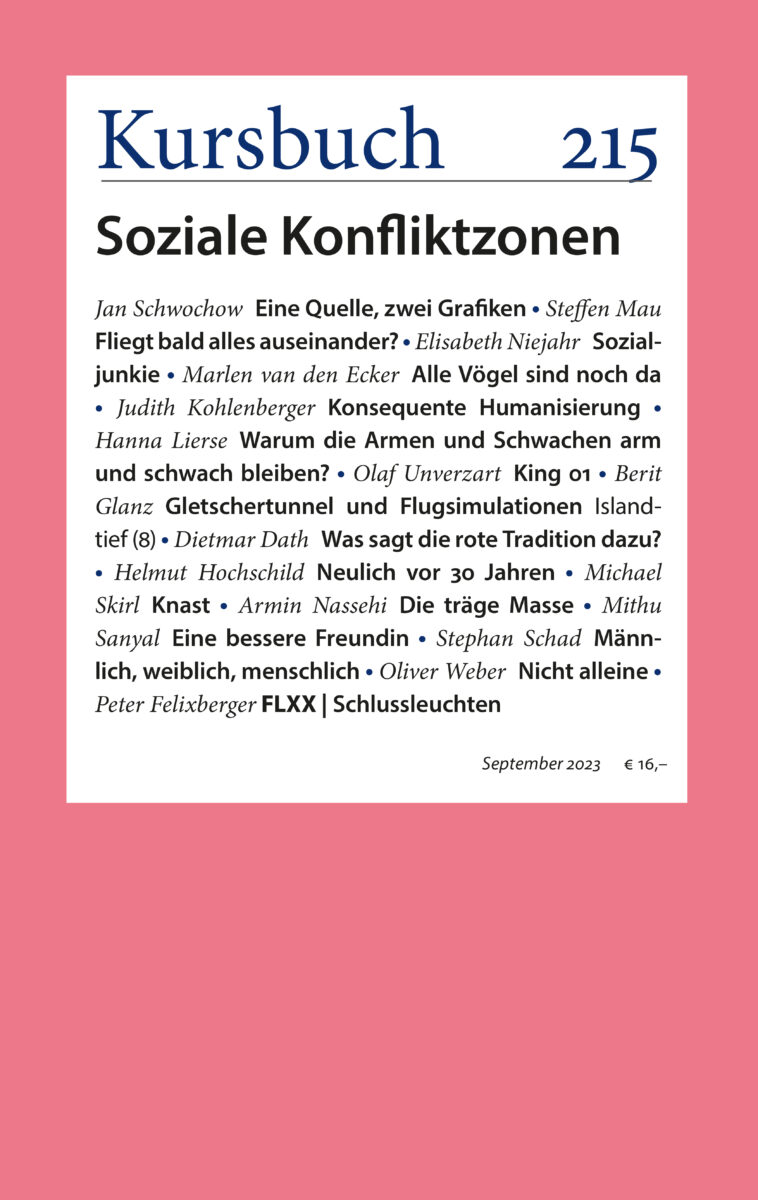
von Armin Nassehi, Beitrag aus Kursbuch 215 „Soziale Konfliktzonen“
In den europäischen Parteiensystemen sind es vor allem die konservativen Parteien, an denen sich der Wandel sozialer Konfliktlagen beobachten lässt. An die Democrazia Christiana in Italien kann sich kaum mehr jemand erinnern, das spanische Parteiensystem hat sich erheblich gewandelt, in Frankreich spielt eine rechtsgerichtete Bewegung eine größere Rolle als eine klassische konservative Partei, überall geraten konservative Parteien von rechts unter Druck oder explizit rechte Parteien treten an deren Stelle, die GOP in den USA nimmt inzwischen revolutionäre Züge an und talibanisiert sich in einigen Regionen.
Nur in Deutschland schien es, dass eine stabile Mitte-rechts-Partei ihre Funktion weiterhin erfüllen kann: einerseits Volkspartei zu sein oder wenigstens den Anspruch darauf zu erheben, andererseits auch konservative Wählerschichten anzusprechen. Doch auch diese letzte verbliebene europäische Mitte-rechts-Volkspartei muss sich einer Konkurrenz von rechts erwehren, die ihr laut Wahlanalysen zwar nicht direkt Wähler abgreift, sondern eher das Nichtwählerpotenzial mobilisiert. Üblicherweise werden diese Entwicklungen Rechtsruck genannt, was sie auch ohne Zweifel sind. Aber damit ist noch lange nicht beschrieben, warum die Musik derzeit eher auf der rechten Seite der Mitte spielt. Einfachere Zeitgenossen führen es in Deutschland auf einen angeblichen Linksruck einer weitgehend rot-grünen Regierungspolitik und auf »woke« Bewegungen zurück. Der Rechtsruck gerät dann zu einer Geste der Notwehr.
Für konservative politische Semantiken ist das eine echte Herausforderung, denn es gelingt ihnen nur schwer, ein eigenes Profil zu entwickeln, ohne in das Fahrwasser rechter und rechtsradikaler Provokationen zu geraten – Formen, die alles Mögliche beanspruchen können, aber gerade nicht, konservativ zu sein. Diese merkwürdige Gemengelage verweist darauf, dass es offensichtlich konservative Bezugsprobleme sind, die politische Öffentlichkeiten nicht nur in Deutschland beschäftigen. Es sieht so aus, als sei die Bearbeitung solcher konservativer Bezugsprobleme die derzeit sichtbarste soziale Konfliktzone.
Es soll in diesem Beitrag die Frage beantwortet werden, warum man einerseits ein wirklich relevantes, legitimes, geradezu notwendiges konservatives Bezugsproblem bestimmen kann, andererseits es aber konservativen Sprechern nur sehr schwer gelingt, dafür Formen zu finden, die mehr zu bieten haben, als sich grüne und woke Hauptgegner zu imaginieren. Ich vermute, dass es einen strategischen kommunikativen Nachteil des konservativen Sprechens gibt – diesem soll hier nachgespürt werden.
Es ist sicher der unstreitige Veränderungsdruck der gegenwärtigen multiplen Krisen, die eher konservative Bezugsprobleme aufrufen. Auch deshalb kommen die gegenwärtigen Konflikte, die zu Kulturkämpfen aufgerundet, als Spaltungen markiert und mit ideologischer Verve geführt werden, derzeit eher von der konservativen Seite – ohne dass man in Deutschland ernsthaft von einer Spaltung der Gesellschaft sprechen kann, so gerne manche das auch hätten.[1] Die Behauptung einer gesellschaftlichen Spaltung und eines wütenden Volkszorns, den die empirische Sozialforschung gar nicht hergibt, ist womöglich eine Ersatzsemantik dafür, das dahinterliegende konservative Bezugsproblem nicht produktiv wenden zu können.
Veränderungsdynamiken haben sich umgekehrt: Im Vergleich zum kulturellen Aufbruch der 1960er- und 1970er-Jahre geht es nicht mehr um Aufstieg, Pluralisierung, Befreiung, Optionssteigerung und Öffnung, sondern um einschränkende Zumutungen, was den Konsum und das Wachstum, die Legitimität von Lebensformen, bewährte Alltagspraktiken und Selbstverständlichkeiten angeht. Die Klimakrise ist das deutlichste Symbol dafür: Abstrakt ist niemand gegen Maßnahmen gegen den Klimawandel, konkret aber gerät eine alternative Heizungstechnologie zum Symbol für alles, »was man uns nehmen« will, garniert mit hübschen Alliterationen: »Habecks Heizungs-Hammer«.
Alles, was links der ominösen Mitte verortet ist, hatte stets einen merkwürdigen Sympathieüberschuss. Prinzipiell sind die Werte, die man mit linken politischen und kulturellen Formen verbindet, solche, denen man beim besten Willen nicht widersprechen kann: Gerechtigkeit und Solidarität, Gleichberechtigung und Pluralismus, Verteilungssensibilität und Gleichheitsversprechen – gegen all das kann man kaum etwas anführen, und es atmet all das, was man auf den ersten Blick mit Modernität und Zeitgemäßem verbindet, nämlich eine positiv besetzte Zielvorstellung, von der übrigens auch die politisch Konservativen profitiert haben, die sich zeitweilig gar nicht mehr so genannt haben. Selbst die am deutlichsten gescheiterten linken Überzeugungen und Projekte können diesem Sympathieüberschuss kaum etwas anhaben. Im Zweifel waren die Experimente dann eben nur imperfekte Formen oder trugen das Label zu Unrecht. Und auch hier muss man sehen, dass die Kategorien durcheinandergeraten. Ob diejenigen, die man »Woke« nennt, tatsächlich Linke sind, wenn dies bedeutet, den Universalismus gegen partikulare Formen von Identitätsansprüchen stark zu machen, wird inzwischen vor allem von Linken selbst diskutiert, jüngst etwa von Susan Neiman.[2]
Auf der anderen Seite ist das fast naturgemäß anders. Konservatives hat nirgendwo diesen Überschuss oder Vorteil, auch weil es stets im Gegensatz zu den genannten Figuren steht: Eine konservative Denkungsart hat womöglich andere Gleichheits-, Solidaritäts- und Gerechtigkeitsvorstellungen. Und es ist im Hinblick auf Fragen der Erneuerung und des gesellschaftspolitischen Fortschritts stets eher auf einer defensiven Seite. Die kulturelle und gesellschaftliche Modernisierung im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts kann, politisch gesprochen, durchaus als ein sozialdemokratisches Projekt verstanden werden – selbst dann, wenn in dieser Zeit die politische Verantwortung auch bei konservativen oder christdemokratischen politischen Akteuren lag. Es blieb kaum etwas anderes übrig, als politisch auf eine gewisse Aufbruchsstimmung zu setzen und optimistisch zu sein.
Es sind eher mobilisierende Bezugsprobleme gewesen, die Steigerung von Optionen und die Aufweichung von traditionellen Bindungen, die zur Leistungsfähigkeit auf vielen Gebieten beigetragen haben. Das freilich scheint sich derzeit umzukehren. Die größte politische Energie scheint derzeit auf der anderen Seite freigelegt zu werden. Es sind in vielen europäischen Ländern, auch in den USA, Motive einer angeblichen Wiederherstellung einer Ordnung, die als ordentliche Ordnung, als geradezu natürliche Ordnung gilt. Das erinnert stark an konservative Reaktionen auf die Französische Revolution, in der eine »harmonische« oder »gewachsene« Ordnung der Gesellschaft stark gemacht wurde, in England verbunden mit dem Namen Edmund Burke, in der frankofonen Welt mit Joseph de Maistre, in Deutschland etwa mit dem Burke-Übersetzer Friedrich von Gentz. Grundtenor bei allen Unterschieden ist der Hinweis auf den Verlust einer bestehenden Ordnung und die Auflösung von bereits vorentschiedenen Bindungen, welcher politischen, religiösen, kulturellen, ethnischen oder regionalen Provenienz auch immer.
Was ist das konservative Bezugsproblem?
Wenn hier von Konservativem die Rede ist, ist das nicht in erster Linie parteipolitisch zu verstehen. Konservative Bezugsprobleme finden sich derzeit in allen politischen Lagern, wenn das bedeutet, dass das Gelingen von Steuerungsmöglichkeiten sich vor allem daran bemisst, ob die Adressaten mit Veränderungs- und Transformationsgeschwindigkeiten und -zumutungen umgehen können. Selbst für die Union als eine der beiden (ehemals) großen bundesrepublikanischen Volksparteien war das Konservative stets nur eine Säule ihres Selbstverständnisses – schon weil sie einerseits als Volkspartei ein erhebliches Spektrum abbilden musste und weil sie andererseits bei ihrer Gründung nicht direkt an die konservativen Parteitraditionen der Weimarer Republik anschließen konnte, deren Versagen und deren Kooperation mit den Nationalsozialisten diesen ihre Machtchancen wesentlich verbessert haben.[3] In der Einleitung zu einem großen Sammelband über die Geschichte der CDU des Herausgebers und Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung, Norbert Lammert, kommt diese Wurzel der Union im Konservatismus semantisch nicht einmal vor.[4] Die Union war im Vergleich zur SPD die konservativere Partei, aber intern war sie dann doch erheblich pluralistischer als eine klassische konservative Partei wäre – wie ja auch die SPD spätestens nach »Bad Godesberg« keine sozialistische Partei im engeren Sinne mehr war, sondern eine pluralistische Volkspartei, mit ihrem ganz eigenen konservativen Bezugsproblem übrigens.[5]
Das Konservative zu bestimmen, ist nicht einfach. Man wird das nicht über Inhalte lösen können, über konkrete Werte und mithilfe traditioneller Weltanschauungen. Vielleicht ist es am überzeugendsten, eher konservative und eher linke oder progressive Denkungsarten danach zu unterscheiden, wie sie sich ihre Klientel vorstellen. Womöglich unterscheiden sie sich darin, dass die »progressive« Linke (»progressiv« als logische, nicht zuletzt geschichtsphilosophische Differenz zu »konservativ«), die Menschen für stark halten will – stark in dem Sinne, dass sie Überzeugungen anpassen und ändern können, dass sie das Andere prämiieren, dass sie überzeugt werden wollen und an ein Summum Bonum glauben. Das Linke umgibt sich gerne mit der Überzeugung, dass das Neue eben durch Überzeugung, durch Theorie, durch Einsicht und Argumente zu erreichen sei – wohlgemerkt: Das Argument lautet nicht, dass Die Linke das kann, aber sie baut auf diese Bereitschaft und figuriert ihre Semantiken um solche Formen. Deshalb leiden eher linke Kommunikationsformen oft an dem Irrtum, man müsse den Menschen nur die normativ angemessenen Argumente mitteilen, dann werden sie sich schon dieser Einsicht fügen und dann ließe sich so etwas wie ein »Umbau« gesellschaftlicher Strukturen erreichen.[6] Die unterstellte »Stärke« besteht darin, den Menschen als einen einsichtsfähigen Adressaten zu imaginieren und ihn so anzusprechen – um sich dann zu wundern, dass das Gegenüber anders, mit anderen Kriterien und träge reagiert.
Vielleicht ist das auch die Erklärung dafür, dass sich Wähler linker und ökologischer Parteien offener für affektive Polarisierung zeigen und womöglich in für sie wichtigen Themen intoleranter sind als konservative Wählergruppen, wie eine neuere Studie zeigt. Darin gibt es kaum Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen und Männern und Frauen. Ältere Befragte neigten übrigens zu höherer Polarisierungsbereitschaft – und die am meisten zur Polarisierung bereite Wählergruppe bilden wenig überraschend die Anhänger der AfD.[7] Einer der Gründe für die diagnostizierte erhebliche affektive Polarisierungsbereitschaft eher linker und grüner Wählergruppen liegt natürlich nicht daran, dass Linke prinzipiell weniger tolerant seien, wie die einschlägige Publizistik diese Befunde aufnahm. Es liegt wohl eher daran, dass das Linke den strategischen Vorteil hat, explizitere Gründe für das nennen zu können, was es programmatisch und inhaltlich vertritt und was es für »progressiv« hält. Wenn man gute Gründe hat, kann man sich weniger vorstellen, dass die Dinge auch anders sein könnten – auch wenn das als Form in der akademischen Linken immer gelehrt wird. Gemeint ist damit aber, weil man sich lange in »Opposition« wähnte, dass die Dinge nicht nur »anders«, sondern jetzt auch »richtig« sein könnten (und dann eigentlich nicht mehr anders sein sollten).
Geht das Linke eher von der Stärke der Menschen aus, erkennt das Konservative dagegen womöglich die Schwäche des Menschen an, die Trägheit der Verhältnisse, die Bedeutung der Bewährung, die lebensweltliche Fundierung alles Geschehens. Konservativ denkt man, wenn man die Verhältnisse in den Vordergrund stellt, in denen man sich vorfindet, die die lebensweltliche und subsidiäre Fundierung etwa von Solidarität, Toleranz, sozialer Gerechtigkeit konservativ fundieren, und das weit weg von rechten Fantasien einer ethnisch oder national fundierten Form einer natürlichen Solidarität. Es lohnt sich die Lektüre von Klassikern etwa der katholischen Soziallehre.[8] Es ist erstaunlicherweise die viel soziologischere Denkungsart, weil sie den Menschen als Ausdruck seiner Verhältnisse ansieht und nicht als deren Subjekt. Nicht der zwanglose Zwang des besseren Arguments, das im Namen einer Symmetrisierung von allem und allen eine geradezu radikale Asymmetrie zwischen dem Gültigen und der Zumutung einzieht, macht das konservative Bezugsproblem aus.[9] Es ist vielmehr das Verständnis für die Trägheit und Widerständigkeit von Veränderungsbereitschaft.
Zwar hat die Soziologie zumeist keinen Sensus fürs Konservative, aber wohl kaum aus systematischen Gründen, sondern eher wegen eines Milieubias ihres Personals. Einige ihrer Grundbegriffe rekurrieren sehr deutlich auf konservative Bezugsprobleme und klammern die Unterstellung des starken Subjekts ein: Der Begriff »Lebenswelt« etwa ist ein eher konservativer Begriff, der eher die trägen Voraussetzungen anspricht als die Autonomie und Kontrollierbarkeit unseres Tuns. Das »Immer schon« der Lebenswelt übersteigt unsere Möglichkeiten, gerade weil es die Bedingung unserer Möglichkeiten bildet. Es stellt stärker auf die eingespielten Routinen ab als auf die autonomen Ressourcen des autonomen Vermögens.[10] Oder der Begriff »Typisierung«, also die Einsicht, dass wir immer schon mit Urteilen ausgestattet sind, bevor wir direkt urteilen, verweist auf eine eher träge und wenig autonome Voraussetzung allen Handelns,[11] und Handeln ist für die Soziologie vergleichsweise unabhängig von theoretischen Vorentscheidungen gerade kein vollständig auf Intentionen basierendes Verhalten, sondern von Voraussetzungen bestimmt, die die Handlung und der Handelnde selbst gerade nicht kontrollieren können.[12] Ähnliches lässt sich für den Kulturbegriff zeigen, für den Einstellungsbegriff oder auch für das Verständnis der sozialen Rolle oder der Institution. All diese Begriffe dezentrieren diesen selbstbewussten, allein auf klaren Urteilen setzenden, in diesem Sinne stark agierenden Akteur und erkennen seine Begrenztheit und seine Schwäche an, indem sie zeigen, wie sehr der Mensch eingebettet ist in Strukturen und Prozesse, deren Voraussetzungen ihm nicht unmittelbar zur Verfügung stehen.
Es sollte deutlich werden, was das konservative Bezugsproblem meint: Die Anerkennung von Trägheitsmomenten, die Anerkenntnis von Kontinuitätsbedürfnissen, die Abwehr von zu großem Veränderungsdruck, vielleicht auch, um Dauerreflexion und die Notwendigkeit von Begründungen latent zu halten. Das konservative Bezugsproblem verweist darauf, dass die Leute nicht alles reflektiert haben wollen, sondern eine gewisse Kontinuität brauchen. Die Mehrheit will ihr tägliches Leben so führen, wie sie es gewohnt ist. Im Grunde ist sie eher konservativ – und das lässt sich etwa daran beobachten, wie sehr sie etwa normativ für Klimaschutzmaßnahmen ist, wie stark aber die Widerstände werden, wenn die Kontinuitäten des eigenen Alltagslebens gestört werden. Man kann das normativ kritisieren und hätte vielleicht Recht damit – aber unterschätzt dann, wie sehr konkrete Lebensformen auf institutionalisierten Gewohnheiten beruhen, die gerade nicht jeden Tag befragt und reflektiert werden.
Und das ist nicht einfache eine Geschmacksfrage. Es ist auch Ausdruck von sehr realen Lebensverhältnissen, die zu negieren ein gehöriger Fehler sein könnte – von beruflichen Karrieren mit Kontinuität, von Familien als ebenso solidarischen wie verpflichtenden Sozialformen, von langfristigen Krediten und privaten Haushaltsmodellen, von Orientierungen an pop- und alltagskulturellen Formen, die es nicht ins Feuilleton oder in kulturwissenschaftliche Abschlussarbeiten schaffen, von womöglich erheblich diverseren und flexibleren Geschlechterrollenmodellen, als es von außen aussieht, die aber nicht unbedingt zu Diskursen aufgerundet werden, von sprachlichem Virtue Signalling ganz zu schweigen. Konservativ ist daran nicht, dass man nicht mit avantgardistischen popkulturellen Formen hantiert oder mit einer Aneignung hochkultureller Formen – konservativ daran ist, die Trägheit der Verhältnisse anzuerkennen. Dass Konservative dafür keine angemessenen Begriffe finden und eher von den »arbeitenden Menschen« oder gar von den »Normalen« sprechen, ist Unsinn, und man kann es problemlos dekonstruieren. Ganze Hauptseminare beschäftigen sich mit nichts anderem als mit dem Nachweis der Arbitrarität des »Normalen«. Der »Nachteil« konservativer Milieus besteht eher darin, für dieses gesamte Trägheitsmilieu, das den Großteil gesellschaftlicher Formen ausmacht, keine Begriffe zu finden – außer solche, die dann selbst in Kulturkampfform geraten oder sich an bestimmten Themen kristallisieren, die dann wirklich problematisch werden, etwa am Migrationsthema.
Von einem konservativen Bezugsproblem zu sprechen, adressiert keineswegs nur solche politischen Akteure, die dieses Label explizit verwenden. Das Trägheitsmoment, Ordnung in eine volatile Welt zu bringen, sich einen Reim darauf zu machen, findet sich auch auf der Gegenseite. Auch sozialdemokratische Milieus (soweit es sie noch gibt) laborieren an diesen trägen Alltagsarrangements, die die Komplexität von Lebensformen und Lebensweisen in institutionellen Lösungen, in Arrangements, in alltagstauglichen Routinen und in einer Idealisierung von Kontinuität kompensieren – als Idealisierung des Alltags bei Alfred Schütz auch eine dieser soziologischen Kategorien, die eher das bedient, was ich hier ein konservatives Bezugsproblem nenne.[13]
Übrigens sind auch die sogenannten woken Milieus träger, als es auf den ersten Blick aussieht – sie zehren nur vom Vorteil, dass ihre Inhalte mehr Informationswert besitzen und leichter begründbar sind, weil diese Art von Trägheit in begrifflicher Gestalt der Disruption, der Veränderung, des Progressiven, der Dauerreflexion auftreten kann. Der strategische Nachteil des Konservativen besteht darin, dass es daran festhalten will, Ordnung ohne weitere Begründung zu erhalten. Soziologisch kann man das eine Latenzfunktion nennen – die ihre Funktion dann verliert, wenn man sie sichtbar macht. Deshalb sehen die konservativen Begründungen unsympathischer aus, verstricken sich in mehr Beharrung als gemeint ist und erleben an sich selbst, dass sie eigentlich keine guten Gründe haben. Keine guten Gründe zu haben (und zu brauchen), kann ein strategischer Vorteil sein, der ins Zentrum habitualisierter Lebensformen trifft. Aber es ist dann ein Nachteil, wenn man nach Gründen gefragt wird. Wie soll man das jedoch begründen?
Das strategische Problem konservativer Kommunikation
Hier beginnt das strategische Problem des Konservativen. Beginnt man, das zu begründen, was letztlich funktionieren soll, dass man auf explizite Begründungen verzichtet, dass man auf latente Formen setzen kann, dass man die Diskursivierung der eigenen Lebensform vermeidet, entsteht ein merkwürdiger Banalitätsverdacht. Man landet dann bei einer Apologie des »Normalen« und verstrickt sich fast automatisch ins Ressentiment – und geht dann selbst einem semantischen Vorrat auf den Leim, der dafür zur Verfügung steht: Formen, die tatsächlich nicht mehr konservativ sind, sondern den unzivilisierten Formen jener Kritiken erliegen, die sich gerade nicht mit der Alltagspluralität der Gesellschaft arrangieren, sondern deren Gefährdung imaginieren – im Bereich der sexuellen Identitäten, der kulturellen Pluralitäten, angeblicher Alltagsverbote usw.[14] Man kann gegen das Verbot des Fleischessens, des Autofahrens, des generischen Maskulinums usw. agitieren, ohne dass jemand bei Verstand solche Verbotsforderungen auch nur ernsthaft aufgestellt hätte.
Noch einmal: Die Herausforderung des konservativen Bezugsproblems besteht darin, die eigene Agenda positiv darstellen zu können. Fast könnte man von einem strukturell auferlegten Bilderverbot sprechen, das das Bewahren gewissermaßen latent halten könnte – sobald Bilder nötig werden, Begründungen und Erklärungen, landet man eher bei hässlichen Sätzen und macht sich in manchen Feldern ununterscheidbar, etwa von der AfD, die am Ende für eine konservative Stammklientel nicht attraktiv sein kann, weil sie aus etwas, das nicht weiter thematisierbar sein sollte, ein explizites Programm macht. Der Vorsitzende der CDU ist damit so überfordert, dass er die Union als eine »Alternative für Deutschland« tituliert, aber »mit Substanz«. Man wüsste zu gern, ob das einfach habitualisierte Assoziationen sind oder ob das mit reflexivem Sinn und Verstand formuliert ist. Beide Möglichkeiten geraten nicht zur Zierde des Sprechers.
Dass das für die Stammklientel der konservativen Volkspartei nicht attraktiv sein kann, zeigen neueste Untersuchungen zum Höhenflug der AfD in Umfragen, denn der Großteil der Umfragegewinne speist sich aus dem Nichtwählerreservoir,[15] und im Hinblick auf die Polarisierungsbereitschaft unterscheiden sich AfD- und Unions-Wähler signifikant.[16] Nur die, die das in eine mitteilungsfähige Form bringen müssen, sind offensichtlich semantisch von dem strategischen Problem konservativer Rede so überfordert, dass es hässlicher wirkt, als es gemeint sein kann.
Schön lässt es sich an der Diskussion übers sprachliche Gendern ablesen, das geradezu zum Großsymbol aufgeblasen wird. Letztlich ist das ganze Thema eine Petitesse, und man kann wissen, dass sich die Dinge am Ende evolutionär entscheiden und sich pragmatische Lösungen durchsetzen werden. Selbst die von manchen provokativ gemeinte These, auch das Nicht-Gendern sei Gendern, weil das generische Maskulinum eben ein Maskulinum sei, bestätigt einerseits das Vorurteil, die Woken sähen nur noch Sex und Gender. Aber es bedeutet natürlich auch, dass das Thema operativ in der Welt ist und dadurch das generische Maskulinum zu einem Maskulinum wird.[17] Aber die Leute haben sich längst daran gewöhnt – und einen moralischen Zwang, es durchzusetzen, gibt es genau genommen nur in einigen Binnenmilieus. Der Alltag ist erheblich gelassener, weniger davon beeindruckt und orientiert sich an Formen, die sich bewähren.
Idealtypisch gesprochen, spricht einiges dafür, dass potenzielle, in diesem Sinne konservative Wählerinnen und Wähler um einiges gelassener sind als jene Funktionäre des Konservativen, die sich eine gepflegte Semantik des Konservativen erarbeiten müssen, die nicht einfach reaktionäre oder rückwärtsgewandte Formen annimmt. Funktionäre kämpfen gegen (und manchmal mit) den Semantiken der Rechten, der faschistoiden Formen der Abgrenzung und der Distinktion, das Publikum will im Sinne des konservativen Bezugsproblems Kontinuitäten, auch plurale. Anders lässt sich nicht erklären, dass faschistoide Politikangebote gerade nicht den sogenannten etablierten Parteien die Klientel wegnehmen, sondern Nichtwähler mobilisieren, die offensichtlich alles andere als gelassen sind.
Die Falschen und das Richtige
Auf politische Akteure, die auch das konservative Bezugsproblem bearbeiten, kann das Land nicht verzichten – eine implodierende Union kann man sich nicht leisten, wenn man sieht, was in anderen Ländern an deren Stelle getreten ist. Vielleicht können die Zumutungen erheblicher Transformationen, die Drastik kollektiver Herausforderungen, die Zumutung einer Veränderungsbereitschaft derzeit eher von Konservativen ausgehen als von denen, für die dies das Hauptanliegen ist. Die Frage ist, ob Konservative ihren Blick auf die Gefahr von rechts in Gestalt der AfD richten oder ob es ihnen gelingt, das legitime konservative Bezugsproblem, die Schwäche der Menschen und die Trägheit der Verhältnisse ernst zu nehmen und in ein starkes Argument zu verwandeln. Es sieht derzeit nicht so aus, aber es wäre auch eine historische Reminiszenz an ähnliche Transformationen in der Geschichte der Bundesrepublik, in der stets die Falschen das Richtige gemacht haben.
Konrad Adenauer ist es gelungen, einem antiwestlich erzogenen konservativen Bürgertum nach dem Krieg die Westbindung abzuringen; Willy Brandt hat als linker Sozialdemokrat sowohl das westliche Selbstbewusstsein in Berlin gegenüber einer sowjetischen Bedrohung als auch eine Versöhnung mit dem Osten ermöglicht, ohne ihm politisch entgegenzukommen; es war der Sozialdemokrat Helmut Schmidt, der das westliche Bündnis gegen die militärischen Bedrohungen der sowjetischen Aufrüstung behauptet hat; und es war Helmut Kohl, der wie kein anderer als Konservativer nationale Souveränität nach Europa abgegeben hat; man kann die Reformen Gerhard Schröders im Detail kritisieren, aber ein solcher Eingriff in den Sozialstaat war wohl nur einem Sozialdemokraten möglich; es war mit Joschka Fischer ein grüner Außenminister, der den ersten Kampfeinsatz der Bundeswehr durchgesetzt hat; und womöglich hätte niemand anderes als eine Kanzlerin wie Angela Merkel in der Flüchtlingskrise die Nerven behalten können. Es ist übrigens mit Winfried Kretschmann ein grüner Ministerpräsident, dessen Erfolgsrezept darin liegt, die konservativen Bezugsprobleme einer kalkulierbaren Transformationszumutung in Rechnung zu stellen. Es war stets so, dass man die Zumutungen dadurch entschärfen konnte, dass sie nicht von denen gefordert und durchgesetzt wurden, denen man dies als Ideologie oder falsches Bewusstsein zurechnen würde. Vielleicht ist das auch ein Erfolgsrezept für die im europäischen Vergleich hohe Stabilität der politischen Institutionen der Bundesrepublik gewesen – und es sind die Konservativen, die derzeit so wenig wissen, woran sie mit sich selbst sind, dass sie diesen Transfer nicht hinbekommen. Die Unbeholfenheit von Friedrich Merz zwischen liberaler Öffnung und kulturkämpferischer Attitüde ist dafür paradigmatisch, und die so wenig kaschierte Form der Instrumentalisierung aller Signalthemen durch Markus Söder ist es erst recht.
Fehlende Köpfe?
Es fehlen dort womöglich die Köpfe, die das verstehen könnten. Am Beispiel des Historikers Andreas Rödder lässt es sich gut zeigen. Es ist nicht lange her, da hatte Rödder in seinem Merkel-kritischen Habitus durchaus eine interessante Position. Er forderte, die Union müsse konservativer werden, zugleich aber offen für aktuelle Herausforderungen und urbane Trägergruppen. Man muss seinen Lösungen nicht zustimmen, aber er hatte durchaus einen Sensus für das, was hier ein konservatives Bezugsproblem genannt wird, das sich gerade nicht an konkreten und exklusiven Inhalten festmacht, sondern an Denkstilen, an Denkungsarten, an Erwartungsstrukturen, durchaus an empirischen Gemengelagen.[18] Heute beobachtet man bei ihm eine geradezu obsessive Perspektive auf die Woken, er macht den Eindruck, als seien die Critical-Whiteness-Theorie und postkoloniale Fragestellungen geradezu die ungeschriebene Verfassung der herrschenden Eliten, als seien all die symbolischen Signalthemen in jener Vordergründigkeit wirksam, wie sie in einer zum Kulturkampf aufgeblasenen veröffentlichten Form erzeugt werden.[19] Das ist an Absurdität kaum zu überbieten – und es führt die Dinge auf jenen Weg, den auch andere konservative Politikformen gegangen sind, die alles »Bürgerliche« verloren haben und ähnlich kulturkämpferisch sind, wie man es teilweise zurecht früheren linken Bewegungen vorgeworfen hat. Die US-amerikanischen Republikaner sind dafür inzwischen die Blaupause. Wer eine wirksame, sogar staatlich organisierte Cancel Culture beobachten will, muss dort hinsehen, wo man inzwischen bis zur Negierung der einfachsten demokratischen Grundregeln geht.[20]
Es steht nach aller Erfahrung zu vermuten, dass die ökologische Transformation, die digitale Herausforderung und die Versöhnung mit der kulturellen Liberalisierung besondere Herausforderungen für konservative Bezugsprobleme sein werden – die Schwäche der Menschen ernst zu nehmen, ohne Pluralisierung und Öffnung abzulehnen. Man muss es deutlich sagen: Hinter die gesellschaftlichen Liberalisierungen und hinter neue Sprecherpositionen früher marginalisierter Gruppen wird man nicht zurückgehen können und noch weniger wollen. Diese Bewegungen sind, bei aller internen Illiberalität, die sie manchmal auch auszeichnet, auch Ausdruck einer Entwicklung, die bewirkt, dass die »bürgerlichen« Ansprüche auf Freiheit und Selbstbestimmung inzwischen von allen Milieus in Anspruch genommen werden (können). Das erzeugt Konflikte. Aber diese Konflikte müssen moderiert werden – wer sich gegen diese Entwicklung auflehnt, wird sie nur verstärken. Das müssen Konservative an sich selbst lernen, wenn sie sich nicht selbst marginalisieren oder nur in eine Antihaltung geraten wollen, die sie zuvor bei anderen immer abgelehnt haben.
Die Verantwortung des Konservatismus für die politische Kultur besteht darin, diese Herausforderung anzunehmen, ohne aufzuhören, diese Verunsicherungen ernst zu nehmen. Derzeit ist die Versuchung groß, in einen kulturellen Backlash zu geraten, so ähnlich wie die sogenannten Woken nur Verachtung für die aufbringen, die in anderen Lebenswelten leben. Glaubt man sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, gibt es die behauptete und instrumentalisierte Spaltung innerhalb der Bevölkerung gerade an den Themen Sexualität / Queerness, Pluralität von Lebensformen usw. kaum, mit Ausnahme des Migrationsthemas.
Die vergleichsweise hohen Umfrageergebnisse für die Union prämiieren damit offensichtlich weniger konkrete Konzepte und die entsprechende Attitüde, sondern vor allem das Bedürfnis, das konservative Bezugsproblem adressieren zu können. Auf der Seite der AfD wird die Union nicht wirklich etwas gewinnen können. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass womöglich nur mit Unterstützung der »Falschen« das »Richtige« möglich ist – es wäre zumindest die Fortsetzung einer bundesrepublikanischen deutschen Tradition. In diesem Lichte gesehen, war Angela Merkel womöglich nicht jene konservative Anomalie, als die sie nun stets stilisiert wird, sondern eine konservative Form auf der Höhe der Zeit. Dass in ihrer Zeit am Ende vieles liegen geblieben ist und einige Transformationen verspätet wurden, ist unbestritten. Eine offene Frage ist, ob das Ausdruck jener Bewirtschaftung eines konservativen Bezugsproblems ist oder ob es schlicht an der langen Regierungszeit lag. Sollte ersteres stimmen, wäre eine Auseinandersetzung damit die entscheidende Herausforderung und nicht die obsessive Zurechnung aller Krisen an einen woken Zeitgeist, dessen Trägergruppe kleiner ist, als es erscheint, dessen Grundintuitionen aber inzwischen »normaler« sind, als es sich der Merz-Flügel der Union vorstellen kann.
Die intellektuelle Herausforderung
Es hängt womöglich viel davon ab, ob es auf der konservativen Seite Köpfe geben wird, die in der Lage sind, das konservative Bezugsproblem ernst zu nehmen, daraus aber keine Konfliktzone entstehen zu lassen, in der sie letztlich nur verlieren können – nicht an die demokratische Konkurrenz, sondern an diejenigen jenseits eines demokratischen Konsenses. Um es noch einmal auf den Punkt zu bringen, besteht die intellektuelle Herausforderung darin, mit folgender Paradoxie umzugehen, die soziologisch betrachtet durchaus relevant ist: Wer das konservative Bezugsproblem bedienen will, muss sich der Tatsache stellen, dass alle soziale Verhandlung auch davon abhängig ist, dass die Grundlagen solchen Verhandelns nicht vollständig verhandelbar sind. Eher »progressive« Denkstile setzen auf deren Visibilisierung, eher »konservative« auf deren Invisibilisierung – mit je komplementären Kosten und Nebenfolgen.
Wird diese Unterscheidung als Kulturkampf geführt, stabilisiert sich eine Konfliktzone, aus der es kaum ein Entrinnen mehr gibt. In solchen Konflikten steigern sich dann auch die beiden Seiten – stabile Konfliktsysteme operieren wie Staubsauger: Sie sammeln alles ein und erzeugen zugleich saubere Verhältnisse. Es bleibt nichts liegen, was irgendwie in den Konfliktantagonismus passen könnte.[21] Die Steigerungslogik dieser Konstellation führt zu einer Kommunikationsform, die mehr Polarisierung impliziert, als tatsächlich zu registrieren ist. Dabei geht es nicht nur um eine »Repräsentationslücke« auf der rechten Seite, die zu schließen wäre. Die Herausforderung ist größer: Es geht um die Frage, wie im politischen System das konservative Bezugsproblem bedient werden kann – und das gilt nicht nur für die Union, sondern auch für eher sozialdemokratische und liberale Milieus, in Teilen wohl auch für grüne. Vielleicht hat das mit am klügsten letztens Luisa Neubauer in Worte gefasst, als sie in einer Rede in Tübingen meinte, die Klimakrise sei nicht auf der linken Seite zu gewinnen.[22]
Zum Schluss noch ein Hinweis auf die AfD: Der Umfrage- und womöglich kommende Wahlerfolg der AfD liegt sicher auch daran, dass diese das konservative Bezugsproblem womöglich besser verstanden haben als Konservative. Sie sind dort erfolgreich, wo sie als Kümmerer auftreten, wo sie so tun können, als gehe es um konkrete Alltagskontinuitäten in strukturgefährdenden Gegenden – in den östlichen Bundesländern lösen sie hier zum Teil die Linkspartei ab. Sie verstellen sich vor Ort als Kümmerer, ohne ihren rechtsradikalen und faschistoiden Kern wirklich zu verdecken. Die intellektuelle Herausforderung fürs Konservative besteht darin, sich nicht umgekehrt zu verstellen und dem rechten Kern der AfD entsprechen zu wollen, statt das konservative Bezugsproblem ernst zu nehmen – und gerade darin eine Brandmauer gegen die rechtsradikale Gefahr aufzubauen. So gesehen besteht die intellektuelle Herausforderung darin, Formen dafür zu finden, das konservative Bezugsproblem so ernst zu nehmen, dass es nicht in semantische Formen kippt, die demokratisch kaum mehr einzuholen sind.
Anmerkungen
[1] Vgl. dazu Steffen Mau in diesem Kursbuch.
[2] Vgl. Susan Neiman: Left is not Woke, Cambridge 2023.
[3] Vgl. Eckhard Jesse: »Das Parteiensystem des Kaiserreichs und der Weimarer Republik«, in: Oskar Niedermayer (Hg.): Handbuch Parteienforschung, Wiesbaden 2013, S. 685–710.
[4] Vgl. Norbert Lammert: »Zur Einführung. Die Union: Christlich und demokratisch«, in: ders. (Hg.): Christlich Demokratische Union. Beiträge und Positionen zur Geschichte der CDU, München 2020, S. 13–26.
[5] In einem sehr instruktiven Radiointerview hat Rudolf Stichweh kürzlich argumentiert, in Deutschland gebe es letztlich keine konservative politische Partei im klassischen Sinne, auch die Union zählt er gerade wegen ihres Charakters als Volkspartei nicht dazu. Dem will ich hier nicht widersprechen, zumal es mir hier weniger um Parteigestalten und konkrete politische Akteure geht, sondern eher um das konservative Bezugsproblem. Vgl. »Konservatismus in Deutschland. Interview von Michael Köhler mit Rudolf Stichweh«, in: Deutschlandfunk (16. Juli 2023). URL: https://www.deutschlandfunk.de/konservativismus-in-deutschland-interview-rudolf-stichweh-soziologe-dlf-385bf1c0-100.html
[6] Vgl. dazu Armin Nassehi: Die letzte Stunde der Wahrheit. Kritik der komplexitätsvergessenen Vernunft, Hamburg 2017, S. 43 ff.
[7] Vgl. Maik Herold, Janine Joachim, Cyrill Otteni und Hans Vorländer: Polarisierung in Deutschland und Europa. Eine Studien zu gesellschaftlichen Spaltungstendenzen in zehn europäischen Ländern, MIDEM-Studie 2023-2, S. 88. URL: https://forum-midem.de/cms/data/fm/user_upload/Publikationen/TUD_MIDEM_Studie_2023-2_Polarisierung_in_Deutschland_und_Europa.pdf
[8] Vgl. Oswald von Nell-Breuning: Gerechtigkeit und Freiheit. Grundzüge katholischer Soziallehre, 2. Aufl., München 1985; aktueller Ursula Nothelle-Wildfeuer: »Die Sozialprinzipien der Katholischen Soziallehre«, in: Anton Rauscher (Hg.): Handbuch der Katholischen Soziallehre, Berlin 2008, S. 143–163.
[9] Vgl. dazu Irmhild Saake: »Zum Umgang mit Asymmetrien und Unterschieden«, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 66 (9/2016), S. 49–54.
[10] Vgl. Armin Nassehi: Gesellschaftliche Grundbegriffe. Ein Glossar der öffentlichen Rede, München 2023, S. 250.
[11] Vgl. ebd., S. 254 f.
[12] Vgl. ebd., S. 134.
[13] Vgl. Alfred Schütz und Thomas Luckmann: Strukturen der Lebenswelt. Band 2, Frankfurt am Main 1984, S. 124 f.
[14] Solche Normalitätsapologien etwa bei Cora Stephan: Lob des Normalen. Vom Glück des Bewährten, München 2021; Birgit Kelle: Noch normal? Das lässt sich gendern: Gender-Politik ist das Problem, nicht die Lösung, München 2020; Judith Sevinç Basad: Schäm dich! Wie Ideologinnen und Ideologen bestimmen, was gut und böse ist, Frankfurt am Main 2021; Sahra Wagenknecht: Die Selbstgerechten. Mein Gegenprogramm – für Gemeinsinn und Zusammenhalt, Frankfurt am Main/New York 2021.
[15] Vgl. etwa die Umfrageergebnisse auf www.wahlkreisprognose.de
[16] Vgl. Maik Herold et al., S. 88.
[17] Vgl. dazu ausführlicher Armin Nassehi: Unbehagen. Theorie der überforderten Gesellschaft, München 2019, S. 276 ff.
[18] Vgl. Andreas Rödder: Konservativ 21.0. Eine Agenda für Deutschland, München 2019.
[19] Vgl. dazu Nils Markwardt: »Plötzlich selbst woke«, in: Zeit online (8. November 2022). URL: https://www.zeit.de/kultur/2022-11/identitaetspolitik-wokeness-bedrohung-thinktank; vgl. auch Kristina Schröder, Andreas Rödder, Susanne Schröter und Ahmad Mansour: »Das woke Deutschland bedroht unsere Freiheit«, in: Die Welt (8. November 2022). URL: https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus241922111/Demokratie-Das-woke-Deutschland-bedroht-unsere-Freiheit.html
[20] Vgl. dazu sehr instruktiv Adrian Daub: Cancel Culture Transfer. Wie eine moralische Panik die Welt erfasst, Berlin 2022.
[21] Vgl. Armin Nassehi: Gesellschaftliche Grundbegriffe. Ein Glossar der öffentlichen Rede, München 2023, S. 178.
[22] Vgl. Peter Unfried: »Das Prinzip Luisa«, in: taz (22. Juli 2023). URL: https://taz.de/!5946749/ Die Formulierung, die Klimakrise sei nicht links zu gewinnen, war laut Zeugen Teil einer Präsentation während der Rede. Ein Belegfoto liegt vor.
-
Versandkostenfrei in Deutschland
-
Versandkostenfrei in Deutschland
-
Versandkostenfrei in Deutschland
-
Versandkostenfrei in Deutschland



